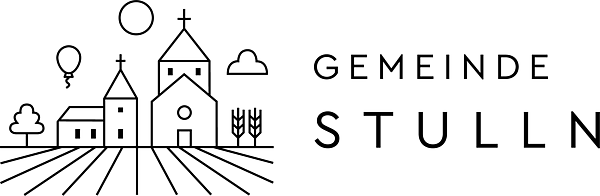Geschichte und Archiv

Über Stulln und seine Umgebung liegen nur sehr spärliche heimatkundliche Urkunden vor. Die Archivalien der Pfarrei Schwarzenfeld, aus denen wohl vieles ersichtlich geworden wäre, sind während der Reformation zu Grunde gegangen. Obwohl wir heute wissen, dass unsere Heimat uraltes Siedlungsgebiet ist, erhalten wir erste Nachrichten zur Ortsgeschichte unseres Dorfes und der Ortschaften unserer Nachbarschaft erst um die Zeit der Jahrtausendwende.
Geschichte bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg
Die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches stärkten ihre königliche Macht dadurch, dass sie sich sehr um die Organisation der Kirche kümmerten, Bischöfe und Äbte ernannten, sie mit umfangreichem Territorialbesitz und Hoheitsrechten ausstatteten und sie so zu ihren Vasallen machten. Kaiser Heinrich II. (973-1024), ehedem Bayernherzog und zu Bad Abbach bei Regensburg geboren, gründete 1007 das Bistum Bamberg und auch das dortige Kloster Sankt Theodor. Es sollte für den ersten geschichtlichen Eintritt unseres Dorfes eine wichtige Rolle spielen.
Am 17. April 1015 unterzeichnete Heinrich II. in Merseburg, dem Ort, in dem er zum König gekrönt wurde und vielleicht deshalb beliebter Residenzort, eine Schenkungsurkunde, in der er oben genanntem Kloster „Suarzinvelt und Weilindorf“ (Schwarzenfeld und Wölsendorf) vermachte. Damit dürfte auch Stulln Bamberger Besitz geworden sein, denn im Jahre 1174 übergab Bischof Hermanus II. von Bamberg seine Güter „in Volsendorf et Stulen“ in die Obhut seines Onkels „Hertnido de Ratendorf“. Damit ist Stulln das erste Mal urkundlich erwähnt.
Den Schutz der Grundherrn für Land und Eigentum, und die damit verbundene Befreiung vom Kriegsdienst, mussten sich die Bauern des Mittelalters teuer erkaufen: Sie gaben ihre Unabhängigkeit auf und waren fortan verpflichtet, von den Erträgen der ihnen zur Bearbeitung überlassenen Bauernhöfe Abgaben zu zahlen und Frondienste zu leisten. In den Urkunden des Klosters Sankt Theodor sind noch 1402 „Hintersassen“ (Hörige) in Stulln dokumentiert.
Zur jährlichen Einsammlung des Geldes wurde der „Seidene Beutel“ nach Stulln und Tännesberg gesandt. Stulln muss recht ertragreich gewesen sein; denn als Konrad der Paulsdorfer, der sich auch "von Murach" nannte, im Jahre 1394 seinen Anteil am Unteren Haus zu Tännesberg an den Pfalzgrafen Ruprecht III. verkaufte, behielt er sich neben einigen Vogteigütern auch den „Seidenen Beutel“ von Stulln vor. Besagter Pfalzgraf wurde 1352 in Amberg geboren und am 21. August 1400 zum römisch-deutschen König gewählt.
„Um diese Zeit wurden auch die Klöster Michelfeld 1119, Ensdorf 1121, Speinshart 1145, Walderbach 1133, Reichenbach 1118 und Waldsassen 1133 gestiftet und reichlich mit Gütern, ja sogar mit ganzen Herrschaften, bereichert, wie überhaupt die Stiftung von Klöstern durch Reichbegüterte im 11. und 12. Jahrhundert zur völligen Manie wurde, und jeder Stifter sich so zu sagen in dem Glauben wiegte, der Himmel halte für ihn deswegen schon eine offene Türe“ (Christof Stahl, „Trischinger Ortschronik“, 1907). So tauchen auch die Namen der anderen Gemeindeteile Stullns in solchen Schenkungs-, später in Verkaufsurkunden oder Salbüchern auf: Hartwig von Brensdorf (Hertwicus de Bremesdorf) in Reichenbacher Urkunden, Säulnhof in Aufzeichnungen des Hofspitals zu Regensburg (1210) bzw. des Klosters Ensdorf (1215). 1367 erhält der Grafenreuther Chunrad der Slatar von Heinrich Wagner zu Trisching Erbrecht auf fünf Jahre, erstes geschichtliches Zeugnis von Grafenricht.
Die exponierte Lage Stullns an der Hauptstraße von Regensburg nach Norden mag wohl ausschlaggebend gewesen sein, dass hier bereits gegen Ende des 16. Jahrhunderts eine Tafernwirtschaft für die Fuhrleute nachgewiesen ist. In Kriegszeiten wirkte sich diese Verkehrsader allerdings immer wieder nachteilig für die Menschen hier aus. Wenn Truppen oder versprengte Soldatenhorden plündernd durch den Ort zogen, hatten sie oft mehr zu leiden als durch Kampfhandlungen. Am 22. Januar 1634, es war die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, erlebten die Stullner den Durchzug des schwedischen Oberst Toubalt mit seinen Soldaten. Kurz vor Ende dieses Krieges 1648 hatte Stulln wieder durch schwedische Truppen unter General Königsmark Drangsale auszustehen. 1664 machte mancherlei Kriegsvolk den Ort unsicher, das aus dem Türkenkrieg heimkehrte. Im Österreichischen Erbfolgekrieg 1740-48 lagerte General Bathyani mit 40 000 Mann in der hiesigen Gegend. 1796 standen sich die Franzosen unter Jourdan und die Österreicher unter Erzherzog Karl bei Amberg gegenüber. Stulln drohte die Niederbrennung. Am 23. August meldet die Chronik ein Reiterscharmützel bei Stulln.
An alten Bauerngeschlechtern sind uns beurkundet: 1455 Ullrich Pellmeier, 1460 Hermann zu Stulln, 1503 Kunz Hermann, 1460 Ludwig von Stulln. Nach dem Salbuch des Amtes Nabburg, ein Abgabe- und Steuerbuch, das der Pfleger Friedrich Steinlinger 1513 anlegte, hatte Andreas Gollner von Stulln "von der praytwiese bei den langen Stegen" einen Wiesenzins von 15 Pfennigen zu zahlen. Stulln hatte auch einen "Zinskeß" (Käsezins) zu entrichten, und zwar sechs Käse von einem Hof und je drei Käse von einem "Söldengütlein", ferner den "Airzins" (Eierzins), und zwar je zwei Schilling von einem Hof und 1 Zentner Eier von einem "Söldengütlein" (etwa 1000 Stück).
Über Jahrhunderte hin dürfte sich das strukturelle Bild Stullns kaum verändert haben. Die landwirtschaftlichen Erträge waren gering. Deshalb war in früheren Zeiten noch mehr Land „unter dem Pflug“ als gegenwärtig. Die erkennbaren Terrassen auf einem Teil der bewaldeten Südhänge des Stullner Berges geben noch heute beredtes Zeugnis ab. Für Handel und Gewerbe in größerem Umfang fehlten die Voraussetzungen. Stulln liegt seit der Zeit seines Bestehens in einer Grenzregion mit all den Nachteilen für eine wirtschaftliche Entwicklung.
Sein historischer Werdegang wurde auch durch die Nähe zu den beiden Nachbarorten Nabburg und Schwarzenfeld beeinflusst. In beiden Orten waren kulturelle Betreuung, Verwaltung, Handel, Gewerbe und Verkehr konzentriert. Nach der Marktordnung der ehemaligen Kreisstadt Nabburg, welche am 7. Januar 1460 der Nabburger Viztum Gerhard Wildgraf zu Dun, zu Kirberg, Reingraf zum Stein erließ, hatte auch Stulln seine Erzeugnisse auf dem Nabburger Wochenmarkt abzuliefern. Auch die Zugehörigkeit zum bayerischen Verwaltungs- und Gerichtsbezirk Nabburg bestimmte die geschichtliche Entwicklung. Kirchlich stand Stulln jahrhundertelang in Abhängigkeit von Schwarzenfeld.
1840 wohnten in Stulln 406 Menschen, und diese Einwohnerzahl wird sich über den Zeitraum des vorausgegangenen halben Jahrtausends kaum verändert haben. Sie änderte sich auch nicht gravierend bis in die Vierzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Stulln ein kleines Dorf mit 24 Hausnummern. Nach dem Zusammenbruch fanden die Menschen Arbeit in den Flussspatgruben, im Stullner Werk und in der Chamotte und Tonwarenfabrik. Die beiden während des Dritten Reiches gebauten Barackenlager waren belegt mit mehr als hundert Flüchtlingsfamilien. Die enorme Bevölkerungsentwicklung auf 1250 Menschen leitete eine beispiellose infrastrukturelle Entwicklung ein.
Wichtige Ereignisse im Laufe der Zeit
- 1174 Bischof Hermann II. von Bamberg überträgt seinem Onkel Hertnid von Rottendorf seinen an St. Theodor verstifteten Grundbesitz in Wölsendorf und Stulln zur Beschützung. Dies ist die erste Urkundliche Erwähnung von Stulln.
- 1420 Zerstörung der Kirche durch die Hussiten.
- 1500 Neubau der Kirche (Hl. Stephanus).
- 1720 Großfeuer in Stulln. Die Feuersbrunst war so schlimm, dass alle Häuser und Stadel im Dorf abzubrennen drohten.
- 1771 Der Schulzwang wurde auch in Stulln eingeführt.
- 1808 Zur Zeit des Häuser- und Rustikalsteuerkatasters waren 19 Anwesen in Stulln gemeldet.
- 1823 Der Flussspatbergbau beginnt. Die Grube "Cäcilia" war 1953 die größte Flussspatgrube der Welt.
- 1887 Seine Königliche Hoheit der Prinzregent Luitpold von Bayern des Königreichs Bayern kam auf seiner Rundreise durch das Gemeindegebiet.
- 1913 Einweihung des 1. Schulhauses in Stulln.
- 1940 Errichtung einer chemischen Fabrik (Fluss-Spat-Chemie).
- 1945 Amerikanische Truppen ziehen in Stulln ein. Der Einmarsch vollzog sich ohne Zerstörungen.
- 1950 Einweihung des neuen Schulhauses.
- 1953 Richtfest der neuen Kirche / 1954 Benediktion.
- 1954 Stulln erhält am 1. Januar ein eigenes Standesamt.
- 1955 In Stulln wird die erste Poststelle eingerichtet.
- 1957 Einweihung des Kindergartens durch Weihbischof Josef Hiltl.
- 1974 Verwaltungsgemeinschaft mit der Marktgemeinde Schwarzenfeld.
- 1978 Die Gemeinde Schwarzach b. Nabburg tritt der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzenfeld bei.
- 1987 Einweihung des neuen Gemeindezentrums am Ortseingang.
- 1999 Einweihung der Mehrzweckhalle.
Archiv
-
Bergbau-Geschichte
-
Kirchen und Marterln
-
Ehrenbürger
-
Chor und Sänger